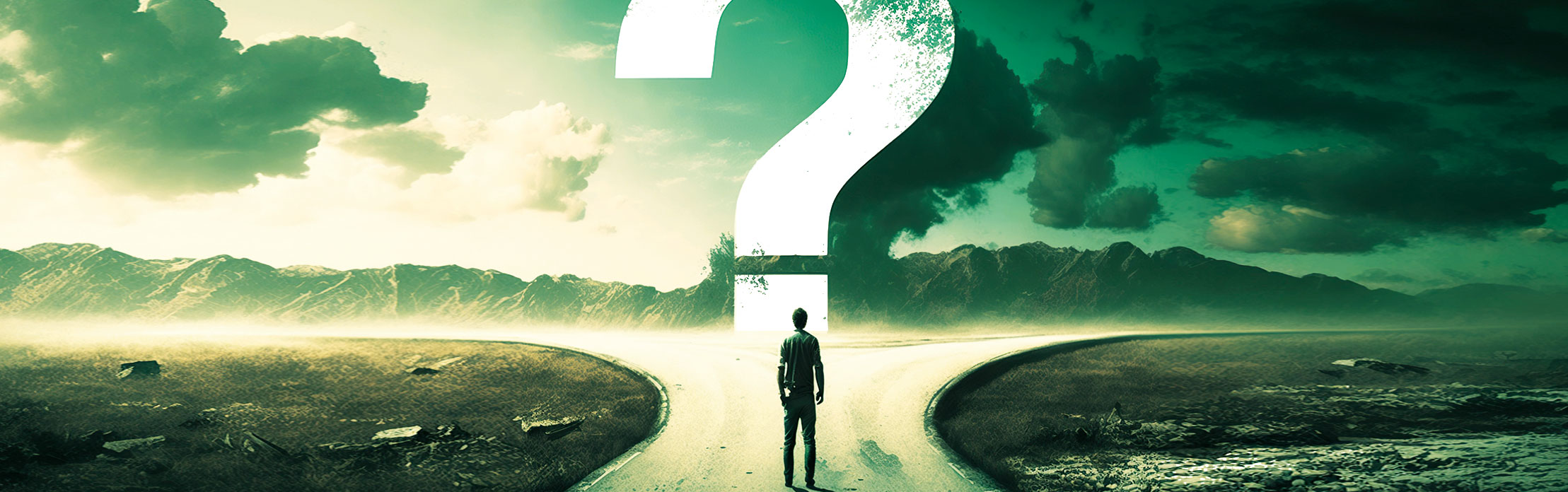
Quo vadis CSV? – Zukunft und Herausforderungen der Computersystemvalidierung
27. Mai 2025Ein Beitrag von Dr. Rudi Herterich zur Entwicklung der Computersystemvalidierung (CSV) und zur Frage, wie diese sich in Zeiten von Cloud und Digitalisierung verändern wird.
Ein Blick zurück – Wie alles begann
Es sind drei Erlebnisse, die meine ganz persönliche Beziehung zur Computersystemvalidierung (CSV) geprägt haben. Wenige Monate nach Gründung der DHC 1996 stand der erste Produktivstart in der Ländergesellschaft eines Pharma-Konzerns an, und wir planten die Go-Live-Party. Interessanterweise lehnte der QM-Leiter eine Teilnahme ab, weil „das R/3-System nicht validiert sei“. Eine kurze Recherche (Google gab es damals noch nicht) führte mich zu einer fünftägigen Schulung bei Concept Heidelberg. Wir beschlossen in dieses Thema zu investieren, ich musste teilnehmen. Der Kurs war mit gut 50 Personen restlos ausgebucht, was mich überraschte; es musste also ein Interesse an diesem Thema bestehen. Wir lernten das V-Modell, die korrelierenden Dokumenttypen und die notwendige Vorgehensweise kennen. Für mich als R/3-Implementierungsberater stellte sich die Frage, wie diese Methode auf ein höchst komplexes integriertes IT-System angewendet werden könnte. Zwei Aspekte erschienen wichtig, erstens herauszufinden, welche Funktionen tatsächlich GxP-kritisch sind und wie sich diese dann entsprechend dem V-Modell validieren lassen. Der Ansatz musste also risikobasiert und prozessorientiert sein. Mit dieser Idee bin ich während des Mittagessens zum Referenten, Dr. Wolfgang Schumacher, gegangen. Er nahm die Idee ohne Kommentar zur Kenntnis, was in diesem Augenblick enttäuschend war. Umso grösser war die Überraschung, als dieser mich nach gut einem halben Jahr anrief und nachfragte, ob wir ihn bei der Validierung von R/3-Systemen in verschiedenen Werken unterstützen wollten. Natürlich wollten wir das und daraus entstand eine viele Jahre andauernde Geschäftsbeziehung.
CSV im Spagat zwischen Bürokratie und Mehrwert
Ein weiteres prägendes Erlebnis war während eines Pitch bei einem grossen Medizintechnik-Unternehmen. Nach Vorstellung unserer Vorgehensweise kommentierte der Vorstand wörtlich: „Dann machen wir also ab jetzt Papier schwarz?…“ Ein Ausdruck des Unverständnisses über den vermeintlichen Dokumentationszwang. Für uns der Anlass, CSV auf den Prüfstand zu stellen: Wo liegt ihr tatsächlicher Nutzen für ein Unternehmen?
Die Bedeutung der Softwarevalidierung verkennen
Noch ein Erlebnis aus einer Zeit, als die Computersystemvalidierung (CSV) längst eine tragende wirtschaftliche Säule unseres Unternehmens war: Der CIO eines Pharma-Konzerns berichtete, dass sein Validierungsteam vor allem aus Mitarbeitenden bestehe, die in der Applikationsbetreuung nicht mehr benötigt würden. Das fühlte sich nicht nach Zukunft an. Wir stellten uns die Frage, ob CSV eine notwendige, wertschöpfende und sinnvolle Aufgabe darstellt. Einige beantworteten diese vielleicht mit „NEIN“, weil sie CSV nur als Pflichtaufgabe zum Bestehen von Audits degradieren, bei der die Einhaltung formaler Kriterien im Vordergrund steht. Aber die Validierung computergestützter Systeme ist so viel mehr.
Was CSV eigentlich leisten muss
Die Grundidee der Validierung computergestützter Systeme ist alles andere als banal: Es geht darum, ein den Anforderungen entsprechendes, dokumentiertes und getestetes IT-System bereitzustellen – zur Sicherstellung der Patientensicherheit. Das ist komplex und interdisziplinär. Notwendig sind:
- Prozesswissen: Verständnis der betroffenen Geschäftsprozesse
- Applikationswissen: Wissen um Funktionen und deren digitale Umsetzung
- Risikoverständnis: Wo entstehen potenzielle Risiken für die Patientensicherheit – und wie lassen sie sich eliminieren?
- Regulatorische Kompetenz: Kenntnis der Anforderungen, die von Audits geprüft werden
Validation as a Service – eine sinnvolle Alternative?
Will man Behörden und Kunden nicht nur teure Audit-Readiness liefern, ist CSV eine anspruchsvolle Aufgabe für Spezialisten, die einen erheblichen Mehrwert generieren. Nur sind diese am Markt schwer zu finden und vor allem nicht günstig. Das stellt gerade kleinere Unternehmen vor grosse Herausforderungen und wirft die Frage auf, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, ein „eigenes“ Validierungsteam zu unterhalten. Cloud-Computing und Application Management sind längst in der IT angekommen, warum dann noch ein Validierungsteam?
Was sind die Vorteile, die CSV extern zu vergeben?
- Expertise und standardisierte Lösungen des Dienstleisters
- Skaleneffekte durch Bündelung gleichartiger Aufgaben
- Kosteneffizienz bei Tools, Ressourcen und Fluktuation
- Entlastung interner Ressourcen bei gleichzeitiger Compliance-Sicherheit
- Risikovermeidung von Ressourcenmangel und Fluktuation
Der Innovationsdruck wächst – und CSV muss mithalten
Wichtigstes Argument CSV als „verlängerte Werkbank“ zu betreiben ist die ungeheure Dynamik, die sich augenblicklich in der IT abspielt. Cloud-Computing verändert die IT-Landschaft grundlegend. Die Innovationszyklen werden immer kürzer: Während ein Releasewechsel grosser ERP-Systeme bisher eine sechsmonatige Re-Validierung nach sich zieht, arbeiten Anbieter wie SAP auf dreimonatige Innovationszyklen hin. CSV darf dabei nicht zum Showstopper werden. Mit der klassischen, weitestgehend manuellen Vorgehensweise ist diese Dynamik nicht zu bewältigen. Was regulierte Branchen jetzt brauchen ist ein weitestgehend automatisierter Validierungsprozess – schnell, zuverlässig, revisionssicher.
DHC treibt digitale Validierung voran
Die DHC arbeitet seit Jahren an digitalen, automatisierten Validierungslösungen für die Life Sciences Industrie. Unsere Spezialisten-Teams unterstützen Unternehmen dabei, jederzeit ein qualitätsgesichertes, valides System einzusetzen. Gemeinsam mit der SAP entwickeln wir aktuell Ansätze, um Innovations- und Validierungsprozesse eng miteinander zu verzahnen.
End-to-End Digital Validation Platform und DHC Smart Validation Accelerator
SAP hat mit der Initiative „End-to-End Digital Validation Platform (E2E DVP)“ einen entscheidenden Schritt in Richtung zukunftsfähiger Validierung gemacht. Ziel ist es, eine durchgängige Verbindung zwischen Systemimplementierung und Validierung zu schaffen – über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Dabei werden sowohl klassische On-Premise-Lösungen als auch moderne, modulare Cloud-Architekturen wie SAP S/4HANA, SAP BTP und SAP Cloud ALM berücksichtigt.
Im Zentrum steht eine klare Strategie: Der Wandel von monolithischen ERP-Systemen hin zu flexiblen, cloudbasierten Lösungen erfordert eine neue Validierungslogik – automatisiert, skalierbar und revisionssicher.
Ein zentraler Bestandteil dieser Toolchain ist der von DHC entwickelte «DHC Smart Validation Accelerator (SVA)». Diese Lösung ermöglicht die automatisierte Erstellung, Verwaltung und Anpassung von Validierungsinhalten GxP-relevanter Systeme – über alle Phasen des Systemlebenszyklus hinweg. Dabei werden technische Funktionen risikobasiert und prozessorientiert mit den relevanten Geschäftsprozessen verknüpft. Das Ergebnis: eine transparente, auditfähige Dokumentation, die sowohl regulatorischen Anforderungen als auch den Erwartungen von Fachabteilungen gerecht wird.
Weitere Informationen zum DHC Smart Validation Accelerator finden Sie [hier].
Wenn Sie mehr über die SAP-Initiative „End-to-End Digital Validation Platform“ erfahren möchten, laden wir Sie herzlich ein zur kostenfreien Websession «GxP Compliance with the End-to-End Digital Validation Platform Initiative“, Dienstag, 3. Juni 2025 – 9:00 Uhr,
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den fachlichen Austausch!